akkordeon.online präsentiert: Akkordeonale 2025
Das Akkordeon hielt seinen Einzug auf Sardinien in der Zeit der industriellen Revolution. Seine Ankunft warf einen Schatten auf die anderen traditionellen Instrumente. Als es die Nodas genannten musikalischen Phrasen der Launeddas, eines heimischen Blasinstruments, übernahm, setzte es sich schnell durch und prägte von da an die sardische Musik. Es war leicht zu spielen und bot neue Möglichkeiten der Rhythmisierung.
Text: Kat Pfeiffer
Die italienische Bezeichnung für die diatonische Ziehharmonika lautet Organetto und ist ein Knopfinstrument mit wechseltönigem Diskant und Bass, das auch als „Wiener Modell“ bekannt ist. Peppino Bande spielt das Organetto bereits seit seinem vierten Lebensjahr. Bei ihm zu Hause musizierten Opa, Vater und der gleichnamige Onkel Peppino, der ihn am meisten beeinflusst hat. Als Jugendlicher begann er in der ersten Folkloregruppe seines Heimatort Sarule zu spielen, im weiteren Verlauf war er auf der ganzen Insel aktiv. Auf der Bühne ist Bande meistens mit seinem Castagnari-Organetto zu sehen. Er spielt aber auch die Fisarmonica, das chromatische Akkordeon, das im Gegenteil zum Organetto ein gleichtöniges Instrument ist.
Peppino Bande hat sich inzwischen zu einem der wichtigsten sardischen Folkmusiker entwickelt. Vom eigentlichen Beruf her Landvermesser, war der italienische Ethnomusikologe Riccardo Tesi ein wichtiges Vorbild für ihn. Bande hat sich seiner wahren Passion gewidmet, Musik von Grund auf gelernt und unterrichtet jetzt Akkordeon an der Schule. Zuerst lernte er aber nach Gehör – so wie Volksmusik in Sardinien bis in die 1950er-Jahre weitergegeben wurde. Er erzählt, dass man damals zu den Musizierenden nach Hause ging, dort die musikalischen Phrasen lernte und dann das, woran man sich noch erinnern konnte, zu Hause weiterhin alleine übte. Dank der sozialen Medien sei es einfacher geworden, sich anhand der unterschiedlichsten Aufnahmen weiterzuentwickeln. Auf jeden Fall werden dabei die traditionellen musikalischen Wurzeln immer beibehalten. Neu hinzu kommt die persönliche Interpretation sowie ein solider Anteil eigener Emotionen.
Neben dem Organetto widmete sich Peppino Bande auch dem Klavier und der Komposition – in allen Projekten, in denen er tätig ist, schreibt er auch Musik. Sein Klavierstudium hat ihm geholfen, seine Perspektive auf Ethnopop hin zu erweitern, und mittlerweile begleitet er auch namhafte sardische Sänger wie Giuliano Marongiu. Diese Erweiterung des musikalischen Spektrums macht sich auch in der Musik seiner Gruppe Zenias bemerkbar, in der er mit seiner Schwester und seinem Bruder spielt, beispielsweise im Song „Balladores De Sardignia“ – regelrechter Folkpop. Sehr beliebt sind die modernen Interpretationen der Band, die alle auf der Insel zum Tanzen bringen. „Sardinien wird immer lebendiger“, sagt Peppino. „Immer mehr junge Menschen widmen sich der Ziehharmonika und sardischer Tanzmusik. Das ist eine gute Zukunftsperspektive!“
Ähnliches stellt Roberto Tangianu fest – die andere Hälfte des Duoprojekts mit Peppino Bande, das bei der Akkordeonale zu hören sein wird – über die Renaissance der Launeddas. Diese gelten als das älteste polyfone Musikinstrument der Welt. Ihr Alter wird anhand des Fundes etruskischer Bronzefiguren mit der Dreifachflöte auf dreitausend Jahre vor Christus geschätzt. Tatsächlich verbirgt sich hinter der Bezeichnung eine ganze Instrumentenfamilie, die sich über die komplette musikalische Skala erstreckt. Wenn die Launeddas in einer Gruppe gespielt werden, erwecken sie den Eindruck einer Klangfülle, die an die als Canto a Tenore bekannten polyharmonischen sardischen Hirtengesänge erinnert, auch wenn sie klanglich in einem höheren Register angesiedelt sind. Eine Kombination aus beiden klingt wirklich einzigartig und geheimnisvoll.
Auch wenn die Launeddas im Rahmen der Akkordeonale „nur“ als Begleitung des Organettos eine Rolle spielen, kommen doch beide Instrumente dabei in einem freundlichen Dialog zur Geltung. „Paesaggi Sonori“ („Klanglandschaften“) nennt das Duo diesen musikalischen „Smalltalk“ über die Landschaften Sardiniens. Bande und Tangianu spielen religiöse Stücke, heidnische Tanzmelodien und sardische Liebeslieder – Musik, die sie bereits in ganz Europa zu Gehör gebracht haben.
Roberto Tangianu spielt die Launeddas seit 33 Jahren. Von Haus aus ist er Journalist und hat die musikalische Leidenschaft von seinem Vater geerbt. Letzterer hat auch sein erstes Instrument gebaut, denn er ist ein Launeddas-Baumeister. Wo genau auf Sardinien die besonderen Schilfgräser wachsen, die man für die Flöten braucht, verrät Tangianu allerdings nicht. Dieses Geheimnis behält jeder Instrumentalist für sich. Er erklärt nur, dass man sie im Februar bei Vollmond schneiden soll. Dann werden sie gelagert, bearbeitet und in den Händen der Baumeister zu Instrumenten. Launeddas bestehen aus drei Rohren: der Su Tumbu oder Bordone – das ist die lange Flöte, die für den Bordunklang verantwortlich ist und keine Grifflöcher hat –, der Mancosedda, die kürzer ist und dem Melodiespiel dient, sowie der Mancosa Manna, die zur Begleitung gespielt wird.
Eine Noda kann bis zu zwanzig Minuten dauern. Der Meister singt sie dem Adepten vor, bevor das Motiv auf das Instrument übertragen und entwickelt wird – das passiert ganz ohne Noten. Wichtig ist es, die Melodie zu beherrschen, weil man sich später auf das Atmen konzentrieren soll. Launeddas werden mit der Blastechnik eines kontinuierlichen Luftzugs gespielt, der sogenannten Zirkularatmung. Eine andere Fähigkeit, die es zu üben gilt, ist der Dialog beider Hände miteinander, die unabhängig voneinander spielen. „Irgendwann passiert das alles auf natürliche Weise“, versichert Tangianu.
Die reiche Tanzerbe Sardiniens entspricht der Vielfalt an Dialekten, Trachten, Traditionen und Musikarten, die sich regional unterscheiden. Im Süden gibt es die Sa Fiudedda oder auch den von den Launeddas abgeleitete Mediana a Pipia. Im Norden tanzt man Logudorese und im Zentrum, auf der Hochebene Barbagia – woher Peppino Bande stammt – Ballu Tundu. Beim Ballo Rotondo, wie man auf Italienisch sagen würde, bewegt man sich im Kreis, in dessen Mitte ein Feuer brennt.
Die Launeddas und Nodas sind untrennbar mit der Entwicklung der sardischen Gesellschaft verbunden. Durch gemeinsames Tanzen und Umarmen kamen die Menschen einander näher, was dazu beitrug, Nachbarschaften zu festigen oder Missverständnisse auszuräumen. Das Zusammenschwingen förderte neue Bekanntschaften und Freundschaften, sogar Verlobungen wurden gefeiert.
Roberto Tangianu hat einige Nodas eigens für das Festival komponiert und für die siebenköpfige internationale Akkordeonale-Band arrangiert. Einen Ballu Tundu hat Peppino Bande ebenso musikalisch entsprechend vorbereitet. Voraussichtlich lässt sich in keinem der Konzertsäle, in denen die Akkordeonale gastiert, in der Mitte ein Feuer entfachen. Es werden sich aber bestimmt Sitznachbarinnen und -nachbarn finden, die sich unter den Armen fassen, um gemeinsam im Rhythmus mit den Füßen zu tippen.
www.facebook.com/autolavaggio.biemme






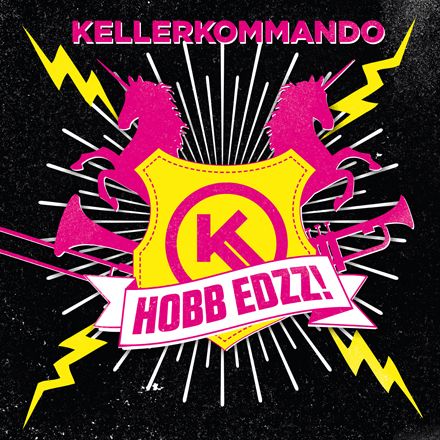

0 Kommentare